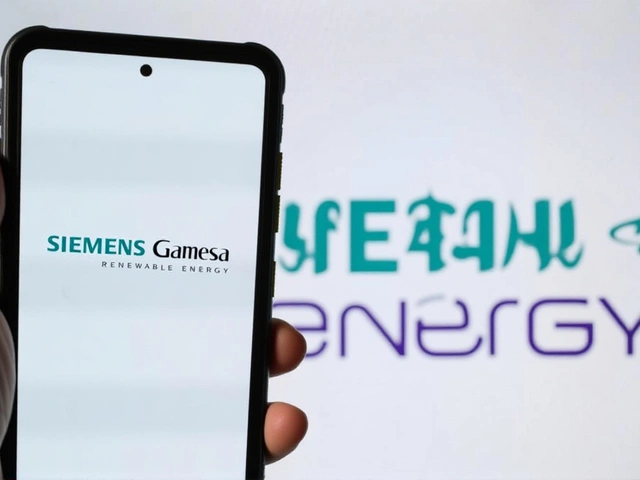Ein Gemälde von Gustav Klimt – das seit fast einem Jahrhundert als verloren galt – wurde im Oktober 2024 von der Wiener Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Grund: Ungarn behauptet, das Werk sei illegal aus Budapest ausgeführt worden. Das Bild, "Portrait of William Nii Nortey Dowuona" aus dem Jahr 1897, ist mit exakt 15 Millionen Euro bewertet und zeigt einen afrikanischen Prinzen aus dem heutigen Ghana. Die Beschlagnahme geschah kurz vor einem geplanten Verkauf auf der TEFAF MaastrichtMaastricht, einem der renommiertesten Kunstmärkte der Welt. Die Galeristen Markus Wienerroither und Thomas Kohlbacher von der Galerie Wienerroither & Kohlbacher GmbH warnen nun: Wenn Österreich nicht eingreift, droht ein Kahlschlag für den gesamten Kunstmarkt.
Ein Gemälde mit einer dunklen Geschichte
Das Bild entstand 1897, als Klimt gerade in seiner künstlerischen Blütezeit war – und als er sich von traditionellen Porträts abwandte. William Nii Nortey Dowuona, ein Prinz aus dem heutigen Ghana, wird in einem weißen Mantel dargestellt, mit einer Haltung, die damals ungewöhnlich selbstbewusst wirkte. Der Klimt-Experte Alfred Weidinger nennt es "bolder und moderner" als ähnliche Werke seiner Zeitgenossen. Nach Klimts Tod im Jahr 1918 wurde das Gemälde 1923 in Wien versteigert. Später gelangte es in den Besitz der jüdischen Wiener Sammlerfamilie Klein: Ernestine und Felix, die in der ehemaligen Klimt-Villa in Hietzing lebten. Als die Nazis 1938 Österreich annektierten, flohen sie – und vertrauten das Bild einem Freund an, der es nach Budapest brachte. Was danach geschah, ist bis heute lückenhaft. Die Familie verlor alles. Und das Bild verschwand.
Wiederentdeckung – und ein Schock für die Galerie
Im Sommer 2023 betrat ein Unbekannter die Galerie Wienerroither & Kohlbacher an der Schellinggasse in Wien. Er wollte das Gemälde verkaufen – aber es war verschmutzt, beschädigt, fast unkenntlich. "Wir dachten, es ist eine Fälschung oder ein schlechter Scherz", erinnert sich Kohlbacher. Doch dann zeigte Weidinger, der seit zwei Jahrzehnten nach diesem Werk suchte, das Bild an. "Ich habe es sofort erkannt. So etwas vergisst man nicht." Die Expertise war einzigartig: die Signatur, die Farbschicht, die Holzplatte – alles stimmte. Der Wert: 15 Millionen Euro. Die Galerie bereitete den Verkauf auf der TEFAF vor. Doch dann kam die Nachricht aus Ungarn.
Ungarns Anspruch – und die Frage der Legalität
Die National Directorate of Cultural Heritage in Budapest behauptet, das Bild sei 2023 ohne Genehmigung aus Ungarn ausgeführt worden – verstoße gegen das Kulturgutschutzgesetz von 2009. Doch hier liegt das Problem: Es gibt keinerlei Dokumente, die belegen, dass das Werk jemals legal in Ungarn eingeführt wurde – geschweige denn, dass es dort seit 1938 verblieben ist. Die Historikerin Dr. Andrea Baresel-Brand von der Deutschen Lost Art Foundation sagt klar: "Unter den Washingtoner Prinzipien zur Rückgabe von NS-Raubkunst ist Ungarns Anspruch rechtlich schwach. Sie können nicht behaupten, etwas sei ihr Eigentum, wenn sie es nie nachweisen können."
Und doch: Ungarn hat eine formelle Anfrage gestellt. Und Österreich muss reagieren. Die Wiener Staatsanwaltschaft hat bis zum 15. Dezember 2024 Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Bis dahin bleibt das Bild in einer sicheren Lagerstätte – unverkauft, ungelöst, umstritten.
Die Restitution war geregelt – jetzt alles wieder offen?
Ein wichtiger Punkt wird oft übersehen: Die Erben von Ernestine Klein hatten bereits im Februar 2024 eine formelle Restitutionsvereinbarung mit dem jetzigen Besitzer, dem Salzburger Sammler Johann Schmidt, unterzeichnet. Der Vertrag war abgeschlossen. Das Bild sollte an die Familie zurückgegeben werden – nicht an Ungarn. "Die Vereinbarung bleibt bestehen", betont die Anwältin Dr. Sarah Berger von Berger & Partner Rechtsanwälte GmbH. "Aber jetzt wird sie von einer fremden Behörde in Frage gestellt. Das ist ein Skandal."
Die Galeristen fürchten, dass ein positives Urteil für Ungarn nicht nur dieses Bild betrifft. "Wenn jedes Land behaupten kann, Kunstwerke zurückzufordern, die vor 85 Jahren durch seine Grenzen kamen – dann wird niemand mehr in Österreich Kunst verkaufen", sagt Wienerroither. "Das ist kein Kulturschutz. Das ist ein Handelsverbot."

Was kommt jetzt?
Die politische Antwort kam schnell: Am 20. Oktober 2024 schrieben Wienerroither und Kohlbacher einen Brief an Bundesminister Werner Kogler (Grüne). Sie fordern eine diplomatische Lösung – und warnen vor einem Schaden von über 500 Millionen Euro jährlich für den österreichischen Kunsthandel. Kogler hat bislang nicht öffentlich Stellung bezogen. Doch hinter den Kulissen laufen Gespräche mit der EU-Kommission und Interpol.
Was bleibt, ist die Frage: Wer hat das Recht, über ein Werk zu entscheiden, das von einem österreichischen Künstler geschaffen wurde, von jüdischen Opfern des Nationalsozialismus besessen wurde, in Ungarn verschwand – und nun von einem Sammler aus Salzburg gehalten wird? Die Geschichte des Bildes ist ein Spiegel der europäischen Tragik des 20. Jahrhunderts. Und jetzt wird sie vor Gericht verhandelt.
Was bedeutet das für andere Sammler?
Die Branche atmet auf – aber nur kurz. Denn wenn Ungarn gewinnt, könnten andere Länder nachziehen: Italien, Polen, die Tschechische Republik. Wer weiß, welche Werke noch in Privatbesitz sind, die irgendwann mal durch ihre Grenzen gingen? Die Angst ist real: Sammler ziehen sich zurück. Auktionen werden verschoben. Banken verweigern Kredite für Kunst. "Wir stehen vor einer neuen Ära der Unsicherheit", sagt ein anonymes Mitglied des Österreichischen Kunsthandelsverbandes. "Wenn man nicht mehr weiß, ob man sein eigenes Gemälde verkaufen darf – was bleibt dann?"
Frequently Asked Questions
Warum wurde das Bild nicht schon früher zurückgegeben?
Weil die Identität des Bildes bis 2023 unbekannt war. Die Erben der Familie Klein wussten nicht, ob es überhaupt existierte. Erst nach der Authentifizierung durch Alfred Weidinger und der Identifizierung der Provenienz konnte eine Restitutionsvereinbarung mit dem jetzigen Besitzer geschlossen werden – und das erst im Februar 2024. Die Ungarn behaupten nun, das Bild sei nach 1938 in ihrem Gebiet gewesen – aber ohne Dokumente, die das beweisen.
Ist Ungarns Anspruch rechtlich haltbar?
Nein – zumindest nicht nach den Washingtoner Prinzipien, die auch Österreich unterzeichnet hat. Diese verlangen klare, dokumentierte Provenienz vor 1938, um einen Anspruch auf Rückgabe zu rechtfertigen. Ungarn kann nicht nachweisen, dass das Bild jemals in seinem Gebiet war – geschweige denn, dass es dort rechtmäßig verblieb. Die Expertin Dr. Baresel-Brand nennt den Anspruch "rechtlich tückisch, aber faktisch unbegründet".
Was passiert, wenn Ungarn gewinnt?
Dann könnte jedes Land Kunstwerke zurückfordern, die jemals über seine Grenzen kamen – egal wie lange her. Das würde den internationalen Kunsthandel lahmlegen. Sammler würden ihre Werke nicht mehr verkaufen, Banken würden keine Kredite mehr geben, Auktionen würden abgesagt. Österreichs Kunstmarkt könnte jährlich über 500 Millionen Euro verlieren – das ist die Prognose der Galeristen.
Warum ist die Rolle der Wiener Galerie so entscheidend?
Weil sie das Werk als erstes authentifiziert hat – und weil sie es legal erworben und zum Verkauf vorbereitet hatte. Die Galerie Wienerroither & Kohlbacher hat keine Verbindung zur illegalen Ausfuhr. Sie ist die Institution, die die Provenienz nachvollziehbar gemacht hat. Wenn sie nun für den Verlust verantwortlich gemacht wird, wird niemand mehr risikobereit sein, verlorene Werke zu recherchieren – und das wäre der größte Verlust für die Erinnerungskultur.
Warum ist das Bild so wertvoll?
Nicht nur wegen der Malerei – sondern wegen der Geschichte. Es ist eines der wenigen Porträts Klimts, das einen afrikanischen Adligen zeigt – ein Zeugnis der globalen Verbindungen seiner Zeit. Außerdem ist es ein seltener Fall von NS-Raubkunst, der nach über 85 Jahren wieder aufgetaucht ist. Der künstlerische Wert ist hoch, der historische Wert unermesslich. Und das macht es zu einem Symbol – nicht nur für Wien, sondern für ganz Europa.
Wird das Bild jemals wieder verkauft?
Das hängt von der Entscheidung der Wiener Staatsanwaltschaft bis zum 15. Dezember 2024 ab. Wenn die Restitutionsvereinbarung mit den Erben der Familie Klein aufrechterhalten wird, könnte das Bild in ein Museum nach Wien oder Berlin kommen – oder in den Besitz der Familie übergehen. Falls Ungarn gewinnt, könnte es nach Budapest wandern. Ein Verkauf ist unwahrscheinlich – denn wer würde ein solches Werk kaufen, wenn sein Eigentum rechtlich unsicher ist?